Von der Flatrate zum schlechten Bild
by Peter Raffelt. Average Reading Time: almost 6 minutes.
Haben sie schon einmal den Satz gehört: »Das hätte ja selbst ich noch besser fotografieren können!«? Wird in Redaktionen gern und oft angewendet, um vermeintlich schlechte Bilder totzureden. Und viele Textkollegen sind tatsächlich davon überzeugt: Jeder kann fotografieren und jeder kann natürlich beurteilen, was ein gutes Bild ist. Aber was hat das eigentlich mit der Qualität der digitalen Medien zu tun? Ich komme darauf zurück.
Die Transformation der Printmedien zu digitalen Medien ist zurzeit in vollem Gange. Unterschiedliche (Geschäfts-)Modelle werden hier und dort ausprobiert und wir werden sehen, welche von ihnen zum Erfolg führen. Das Bildagenturen und deren Honorarstrukturen damit zu tun haben, ist vielleicht auf den ersten Blick nicht ersichtlich aber doch von entscheidender Bedeutung, da es die Nutzung der Bilder in den digitalen Kanälen beeinflusst und somit auch deren optische Qualität bestimmt. Den Honorarstrukturen beeinflussen die Arbeitsweise mit Bildern bzw. deren Auswahl im Redaktionsalltag.
Einen besonderen Reiz für Bildredaktionen haben zum Beispiel die sogenannten Flatrate-, Abonnement- oder Pauschalbezahlmodelle. Der Bildabnehmer zahlt hier für einen gewissen Zeitraum eine bestimmte Gebühr und erhält dafür die Nutzungsrechte an einer (theoretisch) unbegrenzten Anzahl an Bildern. In der Praxis ist aber entweder die Belieferung oder die Downloadzahl definiert und kann den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.
Warum ist das so reizvoll? Bei der Frage, welches Bild für einen bestimmten Zweck genommen wird, muss man verstehen, dass drei Faktoren darüber entscheiden.
- Die Verfügbarkeit: Ein Bild muss aufgefunden werden können und dem Nutzer zur Verfügung stehen, manchmal sehr schnell und immer unkompliziert.
- Die Qualität: Ein Bild muss den inhaltlichen, gestalterischen und / oder technischen Erfordernissen des Abnehmers entsprechen und
- Die Kosten: Ein Bild muss für den verwendeten Zweck zu einem für den Abnehmer angemessenen Preis zu nutzen sein.
Daraus ergeben sich mehrere Vorteile der Pauschalbezahlmodelle: Die einzelne Bildentscheidung kann frei von der Frage der Honorarhöhe getroffen werden. Lediglich die Punkte Verfügbarkeit und Qualität beeinflussen die Entscheidung über die Nutzung. Daher können auch alternative Bildideen flexibel realisiert werde. Wird das Abomodell mit einer automatischen Belieferung vereinbart, wie es z.B. die Nachrichtenagenturen machen, entfällt auch die Frage nach der Verfügbarkeit. Dann kann man sich auf die Qualität konzentrieren.
Findet ein Bildredakteur nun ein Bild ausserhalb dieser Pauschalangebote, sei es, weil diese nicht das entsprechende Motiv anbieten, sei es das deren Qualität nicht ausreicht, muss der Bildredakteur die Nutzbarkeit klären. Dies beginnt mit der individuellen Honorarverhandlung mit dem Anbieter und endet mit dem Werben für die Nutzung eines bestimmten Bildes in der Redaktion, für das diese ja dann ein gesondertes Honorar ausgeben soll. Für das Bild muss also redaktionsintern »gepitched« werden. Der Bildredakteur wird hier zum Bildagenten, der die Qualität mit den Kosten abwägen muss, bzw. deren Übernahme durch Ressortverantwortliche genehmigen lassen muss. Ein guter Bildredakteur hat Kenntnis des Marktes und der Preise, wie auch Überzeugungskraft innerhalb der Redaktion.
Ein gutes Bild finden, reicht nicht aus, es muss auch veröffentlicht werden können.
Oftmals sind es Bilder der Spezialagenturen, die eine separate Bildentscheidung abverlangen. Denn die Pauschalanbieter auf dem Bildermarkt sind Generalisten. Entweder bieten sie Spezialbereiche, wie z.B. Architektur- oder Medizinfotografie erst gar nicht an, oder aber die Qualität reicht gegenüber den Spezialanbietern nicht aus. Damit die Spezialisten gefunden werden, ist es aber erforderlich, auf grossen Rechercheplattformen bzw. -portalen vertreten zu sein oder sich eine Partneragentur zu suchen, die einem den Zugang zu den Bildabnehmern ermöglicht. Daneben sind aber auch die Kontakte zu Bildredaktionen und Bildredakteuren wichtig, die vom Wissen leben, wo sie welche Bilder finden können.
Die Art der Bildnutzung hat sich in den letzten Jahren verändert. Wurden früher Bilder jeweils in einer Zeitung oder einem Magazin gedruckt und danach honoriert, entstanden in den letzten Jahren ganze Produktfamilien, die eine komplexere Nutzung und auch eine komplexere Honorierung zur Folge hatten. Bildabnehmer und Anbieter stritten darüber, ob es sich um eine weitere, neue Nutzungsart handelte oder nur um eine Variation der Ausgangsart.
Der Eintritt in den digitalen Bereich hat das Thema noch einmal komplizierter gemacht, da mitunter gleiche Inhalte auf einem neuen Kanal veröffentlicht wurden. Daraus resultierte das heute übliche Honorargefälle von Print zu Online. Eine Printnutzung in einer Zeitung kostet mehr als eine Digitalnutzung bzw. es gibt Vereinbarungen, die die gleichzeitige Nutzung für die digitalen Kanäle bei einer Printnutzung und -honorierung ermöglichen.
Verlagert sich nun in den nächsten Jahren die Nutzung des Bildmaterials von Print zu Digital, sind neue Honorarmodelle erforderlich, da die alte Ableitung »von Print zu Digital« so nicht mehr existieren wird.
Wahrscheinlich wird es für einen bestimmten Zeitraum der Transformation ein Nutzungshonorar geben müssen, das beide Bereiche abdeckt. Später werden dann Kennzahlen zu bestimmen sein, die Vergleichbar mit der Auflage eines Mediums, eine Grössenordnung der digitalen Nutzung bzw. deren Verbreitung deutlich machen und als Grundlage für eine Honorierung stehen können.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum sich das Digital/Print-Honorargefüge verändern sollte. Durch die »großflächige« Nutzung der oben erwähnten Generalisten des Bildermarkts im Onlinebereich, wirken deren Webseiten häufig gleichförmig und uninspiriert.
Erst wenn optisch spannende und qualitativ hochwertige Geschichten der Printversionen übernommen werden, wird es interessanter. Natürlich ist es nicht so, das die großen Nachrichtenagenturen keine guten Bilder anbieten. Warum finden sich diese Bilder dann zu selten auf Onlineseiten wieder? Weil durch die vorher erwähnte Verwertungskette von Print zu Digital im Onlinebereich darauf verzichtet worden ist, Bildredakteure für die Bildauswahl einzusetzen.
Nichts schien leichter, als einen Onlineproducer aus einem eingehenden Bilderstrom die entsprechenden Fotos auf die Seite stellen zu lassen. Zu oft wurde dann das erste und nicht das beste Bild ausgewählt, inhaltlich falsche verwendet oder auch völlig absurde Bebilderungen vorgenommen, die nicht selten den Spot der Leser auf sich zog.
Wollen wir mit den digitalen Geschwistern der Printmedien auch deren optische und gestalterische Qualität erreichen, müssen wir uns zum einen mit besser zu handhabenden Honorarvereinbarungen beschäftigen und zum anderen Bildredakteure einsetzen, die sich durch ein »geschultes Auge«, wie auch durch eine professionelle Herangehensweise an die bildredaktionelle Arbeit auszeichnen.
Um den Eingangs aufgeführten Gedanken wieder aufzunehmen: Kann man denn die vermeintliche Fähigkeit zur Bildbeurteilung der Textkollegen doch noch irgendwie zur Qualitätssteigerung der digitalen Medien nutzen?
Wenn man es so macht, wie wir es Ende der 90er Jahre in der Bildredaktion der Berliner Zeitung gemacht haben, schon: Lagen die Fotos eines Lokaltermins vor, haben wir sie einer bestimmten Redakteurin gezeigt, die zielstrebig immer das schlechteste Bild ausgewählt hat. So wußten wir zumindest eins: Dieses Bild darf auf gar keinen Fall veröffentlicht werden!
(Dieser Text entstand als Gastbeitrag für die Erstausgabe des PICTA Magazins, der neuen Publikation des Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e.V.[BVPA], Ausgabe 1/2014, Seite 102)
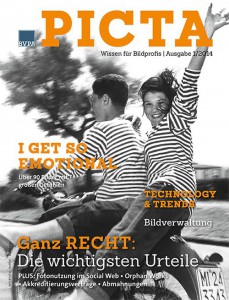
Update 24.07.2014: Interessanter Beitrag dazu auch im Blog von Patrick Lux bzw. beim Mediendienst Integration.

No comments on ‘Von der Flatrate zum schlechten Bild’
Leave a Reply